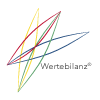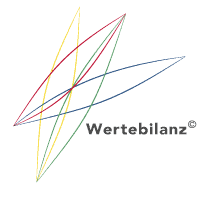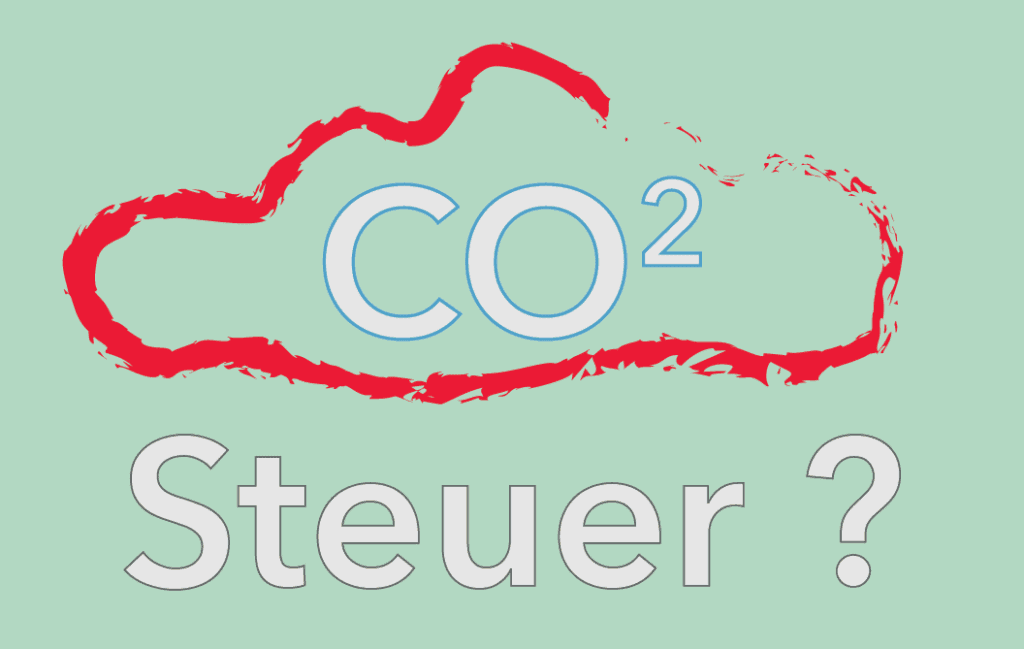
WertePost – CO2 Preise, Steuern und Emissionshandel
17. September 2019
WertePost – Rohstoffe sind Vermögen
30. Oktober 2019Verträge mit Mensch und Natur
– eine Notwendigkeit unserer Zeit
Wir sind es gewohnt, zwischen Unternehmen und Mitarbeitern Verträge wie Arbeitsverträge und Datenschutzvereinbarungen zu schließen. Versicherungen werden im Falle von Unfall oder Berufsunfähigkeit und Altersvorsorge für die Mitarbeiter und das Unternehmen selbst abgeschlossen. Dies hat sich im Laufe der Geschichte der Unternehmenswelt so entwickelt. Wir halten es heute für mehr oder weniger selbstverständlich. In herkömmlichen Bilanzen dokumentieren wir die Altersvorsorge, also für die Mitarbeiter vertraglich geregelte Pensionsverpflichtungen zwischen dem Unternehmen und den Mitarbeitern. Diese werden in der Regel als Rückstellung gebucht. Die Aufwendungen für die Altersversorgungen entrichtet das Unternehmen normalerweise an Versicherungsgesellschaften. Teils verfügen große Unternehmen auch über eigene Altersversorgungswerke. Die Beiträge werden für die spätere Versorgungsleistung vom Unternehmen oder von den Mitarbeitern eingezahlt (Mitarbeiter finanzierte Altersvorsorge MAV, Unternehmens finanzierte Altersvorsorge UAV). Als Rentner erhalten die Mitarbeiter ihren Versorgungsanspruch ausgezahlt. Streng genommen wird ein Vertrag mit der Zukunft geschlossen. Wir verlassen uns als Empfänger der späteren Rente darauf, dass Unternehmen oder Versicherungsgesellschaft zahlungsfähig bleiben. Das System basiert im Prinzip auf Vertrauen. Gleiches gilt für die gesetzliche Rentenversicherung.
Wie sähe unsere Welt aus, wenn wir uns mit ebenso großer Weitsicht der Natur gegenüber (verträglich – vertraglich) verhalten würden? Im übertragenen Sinne bedeutet es, dass weitere Aufwendungen zu buchen wären und rückgestellt werden müssten, damit die Natur auch noch in X Jahrzehnten die Grundlage unseres Lebens und der Waren und Güter bleibt. Bei einem Vertrag mit Natur und Umwelt sähe der Vertrag anders aus. Das Verhalten gewöhnlicher Unternehmen ist allbekannt. Sie externalisieren diese Kosten und halten sie aus den Bilanzen heraus. Zu welchem Preis gegen die Natur ein Produkt hergestellt wird, ist für sie wenig relevant. Der Profit regiert zusammen mit der Wettbewerbsfähigkeit. Es geht letztlich um Erzeugerkosten und den daraus resultierenden Verkaufspreis. Lediglich gesetzliche Umweltauflagen spielen eine Rolle, solange diese nicht umgangen werden können.
Sonnencreme, Korallen und das Sterben des Phytoplanktons
Die vom Aussterben bedrohten Korallenriffe sind ein weiteres gutes Beispiel für mangelnde Verträge von Mensch und Natur. Neuesten Forschungsergebnissen zu Folge gibt es einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Sterben der Korallen und der Nutzung von Sonnencreme. Der verantwortliche chemikalische Wirkstoff heißt Benzoloxid. https://de.wikipedia.org/wiki/Arenoxide. Jährlich gelangen über 10.000 Tonnen Sonnencreme auf Korallen. Sie sind hochgiftig für Korallen und haben deren Absterben zur Folge. Wer trägt hierfür die Verantwortung? Ein anderer Wirkstoff ist Triclosan. Eine 100 g Tube Zahnpasta, die 0,5% Triclosan enthält, tötet das Planktonleben mit einem Volumen der Größe von 50 olympischen Schwimmbecken. Mehr als die Hälfte unserer Sauerstoffproduktion und damit auch CO2 Kompensation leisten die Weltmeere mit dem Phytoplankton.
Seit 50 Jahren ist die Masse an Phytoplankton um 50 Prozent zurückgegangen
Plankton sind mikroskopisch kleine Pflanzen, die in unseren Ozeanen billionenfach schweben. Sie sind die Hüter unseres Erdklimas. Laut NASA sinken sie gegenüber dem Vorjahr weiter um 1%. Mehr als 70% unseres Sauerstoffs wird von diesen erzeugt. Das Meeresphytoplankton ist auch dafür verantwortlich, etwa 50% des weltweiten CO2 zu kompensieren. Alles Leben auf der Erde hängt vom Plankton ab. Wir stehen morgens auf und duschen mit Duschgels, die ozeangiftige Chemikalien enthalten. Wir waschen unsere Kleidung, die oftmals Mikroplastik enthält, in ozeantoxischem Waschpulver. Diese Chemikalien gelangen über unsere Binnengewässer in die Ozeane. Ein zweiter Effekt sorgt dafür, dass die chemischen und pharmazeutischen Schadstoffe im Wasser aufgenommen werden. Seit den 1940er Jahren werden hoch giftige Chemikalien freigesetzt; Herbizide, Pestizide, Antibiotika, Pharmazeutika, giftige Kosmetika, Industrieabfälle und Kunststoffe. Die Natur kann diese Chemikalien zumeist nicht verwandeln, weil es sich nicht um natürliche Chemikalien handelt. Die Zahl der künstlich produzierten Chemikalien steigt täglich um rund 15.000. Auf Kosten der Natur riskieren wir Menschen Kopf und Kragen. Hier wird deutlich, das der Vertrag mit Mensch und Natur nicht geschrieben scheint.
Persistente Schadstoffe
wie Oxybenzon, PCBs, feuerhemmende Stoffe wie PBDE, organisches Quecksilber und Zinn sind hoch toxisch. Sie sind maßgeblich für das Planktonsterben verantwortlich. Sie reichern sich weiter in den Ozeanen und im Sediment an. Die PCB-Konzentration im Marianengraben in mehr als 10.000 m Tiefe ist 50-mal höher als in den belastetsten Flüssen unserer Welt. Tiere oder Pflanzen können diese Bedingungen nicht überleben. In Kombination mit Mikroplastik wirkt der Kunststoff (z.B. Flaschen) wie ein Schwamm und adsorbiert viele dieser Chemikalien und erhöht deren Konzentration um das Millionenfache. Die Ozeane absorbieren Kohlendioxid, Planktonpflanzen nutzen das Kohlendioxid und produzieren damit Sauerstoff. Aber weil wir bereits 50% des Planktons verloren haben, steigt der Kohlendioxidanteil schneller an. Wenn sich Kohlendioxid in Wasser auflöste, bildet es Kohlensäure, die das Wasser sauer macht. Wenn eine trophische Kaskade beginnt, wird es sehr schnell gehen. In einen Zeitraum von vielleicht nur 3 Jahren wird das gesamte Plankton auf Karbonat Basis absterben. Damit sterben auch die meisten Meereslebewesen und mit ihnen die Nahrungsmittelversorgung für etwa zwei Milliarden Menschen. Die Meere werden dann von giftigen Algen, Bakterien und Quallen besiedelt. Der atmosphärische Sauerstoffgehalt sinkt derzeit mehr als viermal schneller als das Kohlendioxid ansteigt. Wenn wir das Plankton verlieren, wird der Sauerstoffgehalt rasch sinken. Das Kohlendioxid wird ansteigen und der Klimawandel wird dynamisierter voranschreiten. Das ozeanische Wasser wird saurer und giftiger.
Auch das Verbrennen von Kohlendioxid und fossilen Brennstoffen hat bekanntlich zur Folge, dass unser Klima sich wandelt. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die CO2-Emissionen bis 2030 so dramatisch sinken werden. Selbst wenn wir morgen alle CO2-Emissionen einstellen würden, wird dies den Planktonprozess nicht bremsen. Wenn wir die Ozeane weiterhin mit Chemikalien zerstören, wird das Lebenserhaltungssystem des Planeten sterben und große Teile unserer Natur und der Menschheit ebenfalls. [wp-svg-icons icon=“quotes-left“ wrap=“i“] Siehe auch
Atomreaktor
Das Beispiel des Betriebs eines Atomkraftwerkes macht die Dynamik der Risiken und Gefahren in Bezug auf die Bilanzierung plastisch nachvollziehbar. Der betreibende Energiekonzern ließ bei Erstellung und Inbetriebnahme außen vor, dass mit dem Betrieb erhebliche, vor allem langfristige Gefahren für Mensch und Natur verbunden sind. Der Staat versäumte, zuständig für das Gemeinwohl nicht nur der derzeitigen Bürger, dieses mit entsprechenden Gesetzen zu regeln. Zuletzt Fukushima hat uns vor Augen geführt, wie Konzern und Staat dies verantwortungslos auf die Spitze treiben. Sie scheinen nichts gelernt zu haben. Es werden weitere AKWs in Japan und weltweit gebaut und Teile des zerstörten Reaktors sollen wieder in Betrieb gehen. Auch in Deutschland haben Politik und Energiewirtschaft versagt. Immer noch lagern Uranabfälle, größtenteils überirdisch, fast ungeschützt in Gorleben. Wir wissen eigentlich nicht, wie sicher das ist. In welcher Weise der Atommüll entsorgt, geschweige denn sicher gelagert werden kann. Loswerden können wir ihn nicht. Seit Fukushima ist das kritische Bewusstsein der Bevölkerung in Deutschland gegen Atomenergie stark angewachsen. Sogar Kanzlerin Merkel hatte eingelenkt. Wir wissen nicht erst seit Fukushima, Sellafield und Tschernobyl, welche Folgen die Radioaktivität auf unsere „strahlende“ Zukunft hat. Schon allein aufgrund der Halbwertzeit von angereichertem Plutonium können auch monetäre Gefahren der Atomkraftwerke und des radioaktiven Mülls überschlägig berechnet werden. Als hypothetische Aufwendungen kalkuliert, könnten diese in die Wertebilanz Einzug erhalten. Eine Kalkulation der möglichen Schäden war sicherlich vor den Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und den Energieversorgern eine Verhandlungsgrundlage. Sonst hätte man sich nicht auf einen Eurowert einigen können. Wenngleich zu befürchten ist, dass diese Kalkulation bei weitem nicht die tatsächlichen Risiken abdeckt. Schlussendlich überwiesen die Energiekonzerne 24 Milliarden Euro in den staatseigenen Atomentsorgungsfond. Nur wurde die Berechnung einige Jahrzehnte zu spät gemacht und dies nun sicherlich auf Kosten unserer Gesellschaft und der zukünftigen Steuerzahler. Diese werden die kommenden Jahrhunderte für die Sicherheit, Kontrolle und sonstige Aufwendungen geradezustehen haben. Die Endlagerung kostet weiterhin immense Summen. Ein fehlender Vertrag zwischen Mensch und Natur
Was, wenn die Energiekonzerne von Anfang gesetzlich gezwungen gewesen wären, für die Folgekosten aufzukommen? So wurden die Aufwendungen für den scheinbar billigen Atomstrom externalisiert: auf Kosten von Natur und Mensch und Gesellschaft: Die Natur wehrt sich bekanntlich nicht so schnell. Die Menschheit neigt zum Schweigen und Wegsehen. Politik und Gesellschaft reagiert oftmals zu langsam, falsch oder gar nicht. Seit Beginn der Bauten für Atomkraftwerke hätten die Bilanzen der Energiekonzerne anders ausgesehen. Auf der Passivseite wären horrende Summen in Rücklagen oder Rückstellungen zu verbuchen. Der Konzern hätte diese erst einmal erwirtschaften müssen. Der Effekt wäre sofort augenscheinlich geworden. Der Atomstrom wäre niemals so günstig auf dem Markt angeboten worden. Und er hätte sich so auf dem Energiemarkt auch durchgesetzt. Mit anderen Worten haben wir Bürger den günstigen Strom zu Lasten der zukünftigen Generationen konsumiert; ohne wahrscheinlich ein Bewusstsein dafür zu haben. Andere Energieerzeugungsformen wie aus Wind oder vor allem mit Sonne wären damit schon in ihren Anfängen wettbewerbsfähiger gewesen.
Fazit
Wir können die Augen nicht davor verschließen, dass bisher externalisierte Werte in unsere Bilanzen integriert werden müssen. Mit anderen Worten: Gefahren und Risiken können nicht weiterhin blind oder vorsätzlich beiseitegelassen werden. Dieser Internalisierungsprozess wird Aufwand kosten, ist jedoch eine große und notwendige Aufgabe unserer Zeit. Nur so kann Nachhaltigkeit gelingen. Wenn Hersteller der Chemikalien und Produzenten von Kosmetika und Kunststoffen die Risiken und Folgen der oben beschriebenen Wirkungen in ihren Bilanzen abbilden, wäre klar, dass sie es anders machten. Alleine wegen der möglichen Wiedergutmachungszahlungen der betroffenen Länder und Menschen. Eine andere Konsequenz wäre, diese Chemikalien gesetzlich zu verbieten. Die Reduzierung des Phytoplanktons ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir ein so manifestes CO2 Problem haben. Die Folgen unseres Unterlassens und Wegsehens werden im Falle des Eintretens der Plankton Katastrophe auch unsere Generation treffen. Wenn nicht, dann werden die unserer Kinder und Kindeskinder die Leidtragenden sein. Es kann keine Frage von Missfallen oder Wegsehen bleiben; auch nicht von falsch verstandener ökonomischer Freiheit. Die Anwendung der Wertebilanz führt in dieser Hinsicht zu Verantwortlichkeit und Klarheit. Wir können uns nur auf den Weg machen, auch diese Werte zu erkennen und neu bilanzieren zu lernen. Vielleicht hat das auch zur Folge, dass sich unsere Enkel bei uns bedanken können.